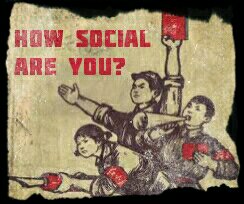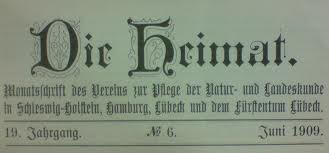Sie werden kein Schauspiel sehen.
Ihre Schaulust wird nicht befriedigt werden.
Sie werden kein Spiel sehen.
Hier wird nicht gespielt werden.
Peter Handke, Publikumsbeschimpfung
Mach mir den Handke
„Sie werden kein Schauspiel sehen.“ Unausweichlich für die Hörer lässt Handke so in seiner bekannten Publikumsbeschimpfung sein Sprechtheater beginnen. Es geht nicht um Schaulust. Und es ist kein Spiel. Das ist ein Satz. Und der ist ein Hinweis eines Sprechers auf das Kommende. Eine kalte Dusche für die Theaterbesucher. Wider all ihre Erwartungen. Sie sollen nicht enttäuscht werden. Sie sollen nicht die gesamte Zeit warten auf das, was nicht kommen wird. Zudem ist das, was immer es ist, nicht belanglos. Eben nicht „nur“ Theater. Nichtmals Schauspiel. Sondern nichtmals Spiel. Es ist ernst. Und das ist gewiss nicht das, das sie erwarten.
Es findet statt in diesem seltsamen Raum namens Theater. Aber es bezieht sich auf das, was draußen geschieht oder geschah. Außerhalb dieser seltsam abgeschirmten Architektur. Diese ist Tor zu einer anderen Welt, aber vielleicht auch Fenster in die bekannte. Doch das Selbstverständliche ist so selbst verständlich nicht. Darum bedürfen wir dieses Fensters. Dann ist aber der Grund, warum wir Theater haben, dieser Schritt nach dem präsentierten Stück in dieses draußen. Dieses ist nicht mehr das, was es vorher war – zumindest wenn die Präsentation gut war. Oder geht es um das Stück und nichts anderes als das Stück? Verweist Theater auf irgendetwas außerhalb seiner selbst?
Egal. Entweder geht es bei Theater um unsere Sicht auf die Welt. Die Dinge. Unsere Erklärungen, Verklärungen und achso unhinterfragbaren Zusammenhänge. Oder eben um Selbstreferentialität. Vom Blabla des Alltags ins Blabla der Aufführung und wieder zurück ins Blabla des Alltags. Das ist der autopoietische Reigen der Postmoderne. Rudelbums in der Beliebigkeit. Aber auch schon hier liegt eine Schicht feinen Staubes des Endes des Endes der Geschichte. Auch das Posthistoire kommt ins Alter.
Mir geht es um Gedanken von Theater heute. Heute im mobilen, im digitalen Zeitalter. Oder wie immer ihr es nennen wollt. Mir kommt es nicht auf Worte an. Nicht auf Schubladen. Ums Theater soll es mir gehen. Nicht um den fluffigen Zeitvertreib „lasst uns doch mal ins Theater gehen!“ Nicht um das Verstehtheater des Bildungsbürgertums. Nicht um Brechts Didaktik der Gesellschaft auf der Piscatorbühne. Nicht um bloße Sensation. Weg mit den Effekten – hin zu den Affekten? Nein. Vielleicht. Große Emotion zwischen rhythmischer Turnübung und tiefempfundener wortloser Empathie sind immer Thema, solange es Menschen gibt. Also wo die Liebenden ihre eigene Sprache sind und keiner anderen bedürfen. Doch haben wir noch die gleichen Gefühle wie unsere Generationen vor uns? Einige Mitmenschen fühlen sich heute von vielem determiniert. Manipuliert. Einige empfinden die NSA-Affäre als Drama, in dem der Whistleblower als Garant der Wahrheit auftritt und die Politik uns nur noch Fiktionen bieten kann. Oder ganz aktuell: Der Fall Edathy. Der entweder eine persönliche Tragödie wird oder ein Politikum ist, in dem der Aufklärer von NSU-Verbrechen abgestraft werden soll. Zumindest gebremst.
Doch das sind Themen. Inhalte. Gehalte. Das Fass ist mir jetzt zu groß für einen kleinen, bescheidenen Blogpost. Aber neben den altbekannten Themen wie Liebe, Tod und Schicksal sind es die Politik dieser Tage sowie die Prozesse der Meinungsbildung, die in sich ihre eigene Tragik tragen. Also hat unsere Zeit genug Themen. Doch zuviel für diesen Text. Denn man könnte auch fragen: Was, wenn alles nur Theater ist, da draußen? Dann sucht man Zuflucht in der Anstalt, wo man weiß, dass alles nur Theater ist.
Flashmobbing, Hangouterei und rhizomatisches Theater
Mir soll es im Folgenden um neue Orte gehen. Orte, an denen Theater heute geschehen kann. Das ist nicht nur der altehrwürdige Kulturtempel, obwohl nichts gegen ihn spricht. Oder sehr viel. Aber auch das wäre ein anderer Artikel.
Ich behaupte jetzt in diesem Text voller Emphase: Es gibt heute noch mehr Orte, an denen Theater stattfinden kann. Womöglich sogar muss. Neue Orte. Alte Orte. Auf ein haudrauf Allesmussjetztdigitalsein kommt es mir nicht an. Sondern einzig: Theater kann überall geschehen. Auch auf der Straße. Mitten im Trubel. Das ist beispielsweise ein alter Ort. Doch für Theater oft noch ungenutzt.
Flashmobs sind eine neue zeitgenössische Form scheinbar spontanen Theaters an diesem Ort. Es zählt die Überraschung. Die Verwunderung. Die Unausweichlichkeit. Doch nicht die des Hörens, sondern der Einbettung in den Alltag. Hinterfragt wird mehr der Ort und die dort üblichen Tätigkeiten. Vor oder in Cafés mit WLAN böte sich ein Wischmob an. So nennen ich jetzt einen Flashmob mit dem Tanz der Gesten auf Smartphones oder Tablets aber ohne diese Geräte. Das ist Pantomime auf der Straße. So wäre diese Art sogar zwischen Theater, Varieté und Zirkus angesiedelt. Ziemlich old fashion wie man merkt.
Fast jeder kennt Beispiele auf YouTube, wo Menschenmassen in Bewegung und Starre sich verhalten als wollten sie die Beuysschen Aggregatszustände von dessen Bildhauertheorie bebildern. Erst eingebunden in die Menge der Nichtschauspieler trennen sie sich, bilden ihre eigene Form und gehen nach einiger Zeit wieder in der allgemeinen Masse auf. Oder sie beginnen zu singen, musizieren und tanzen, um nach kurzweiliger Anstrengung wieder in der Konformität der Masse einzugehen. Form und Auflösung. Theater als Moment.
Flashmobs sind embedded theatre. Mobile happening. Location based performance. Wer ist das Publikum? Die Umstehenden? Kann man so sehen, muss man aber nicht. Ohne sie funktioniert keine Einbindung. Keine Begrenzung. Keine Abgrenzung. Sie sind wesentlich für einen funktionierenden Flashmob. Sollte dieser Flashmob aufgenommen und auf YouTube gestreamt werden, so sind zumindest die User auf YouTube sowas wie das Publikum, wobei fraglich ist, ob sie der Definition eines Publikums von Maletzke entsprechen, denn sie interagieren miteinander. Nach Maletzke ist ein Publikum sich untereinander fremd. Das ist beim klassischen Theater so. Auch beim TV. Aber nicht mehr zu Zeiten von Social Media. In YouTube sind alle wenigstens via GMail oder Google Plus miteinander vernetzt. In Kommentaren besteht die Möglichkeit zum Austausch. Über Google Plus sogar über Kreise, Communities und Seiten. Sie können sich sogar im hauseigenen Videokonferenzsystem von YouTube oder Google Plus aus untereinander sehen und miteinander kommunizieren.
Darum jetzt folgerichtig gefragt: Warum kein Hangout-Theater? Extra Aufführungen via Google Hangout. Entweder als Schauspiel für sich oder eingebettet mit Gästen. Nichtschauspielern. Mehr Improvisation als Darbietung. Weniger Wiederholung als je neues Wagnis. Wem das eben Geschriebene zu digital ist, dann lasst mich nochmals meinen Gedanken anders beginnen: Warum kein Wohnzimmer-Theater? Theater in geschlossenen Räumen. Wohnzimmern halt. Meinetwegen ebenfalls in der Garage. Vor der Tür. Draußen vor der Tür. Vor Ort kein Publikum. Wer am Ort ist nimmt am Spiel teil oder nicht. Zur selben Zeit an anderem Ort: ein anderer Trupp. In einem anderen Wohnzimmer. Oder Garage. Oder vor der Tür. Egal. Nur woanders, aber zur gleichen Zeit. Maximal zehn solche Trupps können zusammenfinden. Die Grenze setzt das Videokonferenzsystem Hangout von Google. Oder spannender: Fünf solche Schauspielgruppen, die sich alle ihr eigenes Stück erarbeiten (wer wohl berücksichtigen wird, dass die unterschiedlichen Gruppen auch interagieren können?), treffen auf fünf Nichtschauspieler. Wer agiert mit wem? Wer reagiert worauf? Wer spielt nur für sich? Und übertragen wird das Ganze per Hangout on Air – also mit gleichzeitigem Stream nach YouTube. Hier wäre noch mehr zu überlegen. Beispielsweise: Was ist mit den zuschauenden Usern auf YouTube? Welche Rolle haben sie – klassisches Publikum? Doch ich will es mal hier beim bislang Angerissenen belassen.
Abschließender Gedanke: rhizomatisches Theater als ein Beispiel für Stadtmarketing. Das Ganze als Gewebe. Wir sind immer schon mittendrin. Die Stadt als Ort von Theater. Ein(?) Stück in mehreren Erprobungen. Der Überblick über das Ganze ist so alt wie der Traum vom Fliegen. Entweder Ikarus (höher, immer höher der Sonne entgegen) oder der Flaneur – andere Rollen bleiben uns nicht. Vertikale oder horizontale Bewegung. Der Spaziergänger durchstreift und entdeckt im kurzweiligen Zeitvertreib. Zwar entgeht ihm die Vogelperspektive von Ikarus, aber er bleibt auf dem Boden. Entdecken kann er ein MashUp von Kleinststücken (beispielsweise Wohnzimmertheater + Flashmobs). Aber nur, wenn diese aufeinander abgestimmt geplant werden. In sich abgeschlossen. Für sich stehend. Aber aufeinander bezogen. Irgendwie. Es lebe das Ganze der Fragmente! Jeder „Betrachter“ durchstreift verschiedene Stücke, jeder in anderer Reihenfolge, manche in Gruppen vielleicht auch die gleichen. Mal mehr Betrachter, dann mehr selbst Akteur.
Immer dabei: digitales Begleitmaterial. Je mehr der Flaneur interagieren kann, umso mehr wird Theater zum Game. So könnte Stadtmarketing das gesamte urbane Umfeld zu einem einzigen Theater machen. Zu einem Theaterspiel. Oder Spieltheater. Zu einem Stück in mehreren Erprobungen. Und für immer digital festgehalten via YouTube. Aber bitte: gewinnen kann man da nichts. Gewinn wird nur vorgegaukelt, damit weitere Spiele gespielt werden. „Um zu erfahren, welchen Sinn das Leben hat, müssen sie erst die nächst höhere Spielebene gewonnen haben.“ Oder „die Antwort überreicht Ihnen Herr Godot. Bitte warten.“ Aber das wäre nur ein weiteres mögliches Thema.
Dieses ist mein bescheidener Beitrag zur Blogparade „Alles ’nur‘ Theater?“ vom Theater Heilbronn http://blog.theater-heilbronn.de/?p=6276 . Mit Theater habe ich dieser Tage leider wenig zu tun. Während meiner Schulzeit führten wir im LK Deutsch „Unsere kleine Stadt“ von Thornton Wilder auf. Ich spielte den Professor und den Texaner. Das komplette Bühnenbild konzipierte und setzte ich allein um. Außerdem hielt ich ein ausuferndes Referat über Theatertheorien. Als Schüler besuchte ich mehrere Aufführungen des Landestheaters Detmold. Dort hatten wir eines dieser berühmt-berüchtigten Abos. Dort geschah auch ein Erstkontakt mit Wagner. Während meines Studium dann Besuch von Wagneropern in Köln und Frankfurt. Für meine Erste Staatsarbeit in Kunst ebenso auch Ballettbesuche im Folkwang in Essen. Pina Bausch war zugesagt, passte nur terminlich nicht.